Willkommen im globalen Uhrenspagat
Zweimal im Jahr stellt die Welt die Zeit um.
Nicht die ganze Welt, wohlgemerkt. Nur die Teile davon, die glauben, das sei eine gute Idee.
Ich lebe in Mexiko.
Mexiko stellt keine Uhren mehr um. Mexiko schaut auf die Zeit, zuckt mit den Schultern und geht Mittagessen.
Ich war stolz darauf.
Dachte, ich hätte das System durchschaut: Keine Sommerzeit, kein Drama.
Dann kam der März.
Und plötzlich war es wieder so weit: Mein Gehirn stürzte ab.
Nicht wegen meiner Uhr. Die blieb, wo sie war – wie ein Kaktus im Wind.
Sondern weil alle anderen ihre verdammten Uhren umstellten. Nur nicht synchron.
Die USA legten vor.
Wie immer.
Zack – Stunde vorgestellt, als wäre es ein patriotischer Akt.
Ich bemerkte es nicht sofort.
Ich wunderte mich nur, warum meine amerikanischen Kolleg:innen plötzlich so… müde klangen.
„Bin schon seit 5 Uhr wach“, schrieb einer.
Ich dachte: Wow, Disziplin!
Dann: Moment – warum steht er auf, bevor ich ins Bett gehe?
Ich googelte:
„USA Sommerzeit 2025“
Google antwortete kühl:
„Beginn: 9. März“
Es war der 10. März.
Ich war also einen Tag zu spät in einer Zeit, die ich gar nicht betreten hatte.
Aber gut, dachte ich. Ich passe mich an.
Eine Stunde vor im Kopf.
Kein Problem.
Doch kaum hatte mein innerer Kalender diesen Sprung akzeptiert, kam Deutschland um die Ecke.
Mit einer anderen Umstellung. Später.
Zwei Wochen später, um genau zu sein.
Ich lebte nun also offiziell in Mexiko, dachte wie ein Amerikaner und kommunizierte mit Deutschen, die noch eine Stunde zurücklagen – aber nur temporär.
Es war, als würde mein Gehirn Pingpong spielen, aber beide Schläger sind aus Wackelpudding.
Ich stellte fest:
Ich lebe nicht in einer Zeitzone.
Ich lebe in einem zeitlichen Minenfeld.
Jeder Kontakt mit der Außenwelt kann mich aus dem Rhythmus bringen.
Ein Zoom-Call um 9 Uhr bei mir ist mal 16 Uhr, mal 15 Uhr, mal gestern.
Ich bin chronologisch unbewaffnet.
Und das war erst die erste Woche.

Amerika: Früher aufstehen für Verwirrung mit Sternenbanner
Die Amerikaner stellen ihre Uhren um, als hätten sie’s erfunden.
Und vielleicht haben sie das auch – neben Fast Food, Reality-TV und dem imperialistischen Lächeln bei diplomatischen Katastrophen.
Am zweiten Sonntag im März wird einfach gesagt:
„Hey folks, let’s jump ahead!“
Und alle springen.
Die Sonne geht plötzlich zu einer anderen Zeit auf, was niemanden zu interessieren scheint, außer mich – weil ich’s nicht mitbekommen habe.
Ich saß also in Mexiko, wo die Sonne einfach tut, was sie immer tut, und wunderte mich, warum mein amerikanischer Kalender mir einen Termin vorschlug, der… irgendwie früher war.
Aber nicht in meiner Welt.
Nur in seiner.
In meiner war es noch dieselbe Zeit wie vorgestern.
In seiner war es… eine neue Ära.
Ich stellte also meine Kalender-App auf „USA-Modus“, was bedeutete, dass mein Handy gleichzeitig:
•9:00 Uhr Mexiko
•11:00 Uhr New York
•10:00 Uhr Chicago
• und mentale Kernschmelze bei mir anzeigte.
Ich kam zu spät zu einem Zoom-Call, zu früh zu einem Slack-Check-in und exakt pünktlich zur Erkenntnis, dass ich in keiner dieser Zeitzonen wirklich existiere.
Die US-Amerikaner selbst?
Cool wie immer.
„Ah, right, time change.“
Time change!
Als wäre es eine neue Frisur oder ein Reifenwechsel.
Ich nickte mit zusammengebissenen Zähnen in die Kamera und lachte höflich, während ich mir innerlich eine Welt wünschte, in der alle einfach auf mexikanischer Zeit lebten:
Gemütlich, eindeutig und zu 90 % sonnig.
Doch ich wusste:
Die Deutschen hatten ihre Zeitreise noch vor sich.
Und dann wird’s richtig haarig.

Deutschland: Präzise ins Chaos
Die Deutschen stellen ihre Uhren nicht um.
Sie implementieren eine temporäre Strukturverlagerung im kollektiven Zeitmodell.
So fühlt es sich zumindest an.
Es geschieht nicht spontan.
Es wird geplant.
Diskutiert.
Reguliert.
Die Sommerzeit ist kein Wetter, sie ist ein Verwaltungsakt.
Zwei Wochen nach den USA – zwei Wochen, in denen ich bereits geistig halb in Florida und halb in Oaxaca lebe – entscheidet Deutschland, seine Stunde nachzuholen.
Oder vorzulegen.
Oder zu klauen.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich bekam eine E-Mail von einem deutschen Bekannten, Betreff:
„Ab Montag eine Stunde früher“
Ich dachte: Was denn? Steuererklärung? Frühstück? Klimakollaps?
Nein. Zoom-Call.
Ich war fassungslos.
Ich fragte nach: „Ihr habt jetzt auch Zeitumstellung?“
Antwort: „Natürlich. Immer. Letzter Sonntag im März.“
Mit dieser Betonung auf „immer“, die klingt wie: „Daran erkennt man zivilisierte Gesellschaften.“
Ich aktualisierte zum dritten Mal in zwei Wochen meine Kalender-App.
Meine Termine sprangen wie Flöhe auf Koffein.
Ich war plötzlich gleichzeitig zu spät, zu früh und in der falschen Woche.
Ich hatte nun:
•Die amerikanische Zeit (bereits angepasst)
•Die deutsche Zeit (jetzt ebenfalls angepasst)
•Die mexikanische Zeit (unberührt und seelenruhig)
•Und mein Gehirn (leicht durchgebraten, aber noch genießbar)
Ich begann, Nachrichten mit dem Zusatz zu versehen:
„Welche Uhr meinst du genau?“
„In deiner oder in meiner Realität?“
„Vor der Umstellung oder nach der Umstellung?“
„Ist das Uhrzeit oder Philosophie?“
Ich bestellte mir eine neue Armbanduhr.
Eine rein mechanische.
Sie sollte nur Mexiko-Zeit anzeigen.
Und zwar immer.
Die Beschreibung versprach:
„Ohne Funk, ohne Internet, ohne Stress.“
Ich habe selten so viel Vertrauen in ein Produkt gehabt.

Kontrollversuche mit Kalender, Kaffee und Kapitulation?
Ich beschloss, die Sache endlich in den Griff zu bekommen.
Der Plan:
Ein universell synchronisierter, farbcodierter Kalender mit eingebauten Zeitzonen-Filtern und Erinnerungen, die mich sanft an Termine erinnern – ohne mich gleichzeitig an meiner Existenz zweifeln zu lassen.
Ich wählte Farben:
•Blau für Mexiko (beruhigend)
•Rot für Deutschland (alarmierend)
•Gelb für die USA (vorsichtig euphorisch)
•Grau für mich selbst (aus Prinzip)
Ich plante. Ich ordnete. Ich fühlte mich kurz wie ein Manager in einem Hochsicherheitslabor, das internationale Atomuhrzeit koordiniert.
Für drei Stunden war ich ein Gott der Zeit.
Dann meldete sich ein deutscher Kollege mit den Worten:
„Du, wir haben das Meeting auf nächste Woche verschoben. Und übrigens – wir haben es wieder auf 15 Uhr gelegt. Aber deiner oder meiner Zeit?“
Ich antwortete:
„Ja.“
Mehr brachte ich nicht zustande.
Meine mechanische Armbanduhr kam an.
Wunderschön. Klassisch.
Ich stellte sie auf „mexikanisch“.
Sie zeigte 12:00 Uhr.
In meiner Realität war es 13:00 Uhr in Deutschland, 15:00 Uhr in Boston und absolut keine Uhrzeit mehr in meinem Kopf.
Ich trank Kaffee.
Dann nochmal.
Dann vergaß ich, welchen.
Dann stellte ich fest, dass ich eine Erinnerung auf 10 Uhr gesetzt hatte – die mir um 9:00 Uhr angezeigt wurde, weil mein Laptop sich automatisch an die deutsche Sommerzeit angepasst hatte.
Aber nur in der Kalender-App.
Nicht im System.
Ich fragte mich, ob es sein kann, dass ich zwar körperlich ruhig in Mexiko sitze, aber mental als Pendler zwischen Raum und Zeit durch die Hölle reise.
Vielleicht ist das gar kein Jetlag.
Vielleicht ist das Zeit-Schizophrenie.
Ich googelte es.
Es gibt kein Wort dafür.
Noch nicht.
Aber ich war nah dran, eins zu erfinden.
Dann vergaß ich wieder, wie spät es war.
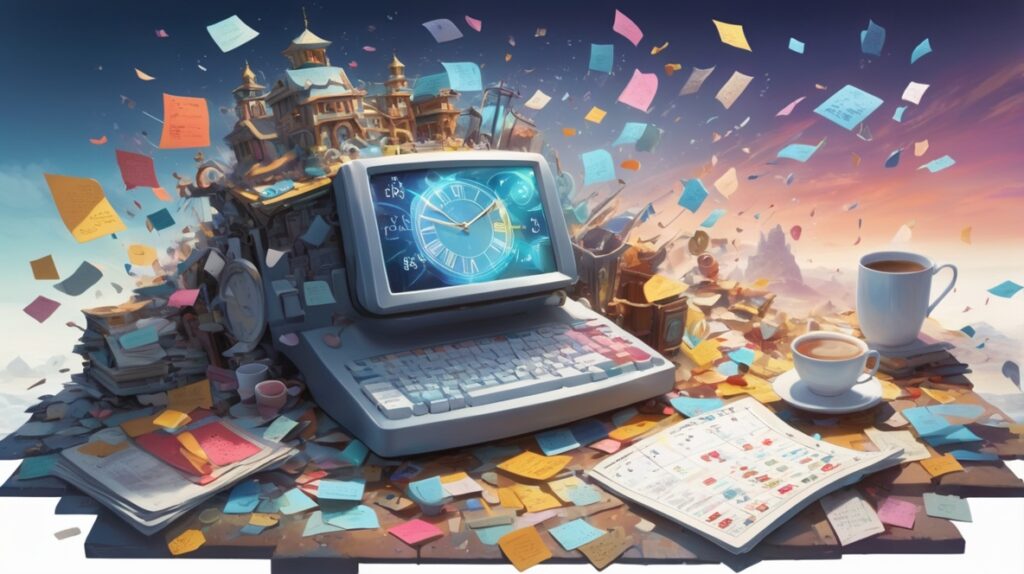
Anpassung, Akzeptanz und die nächste Zeitumstellung?
Nach drei Wochen hatte ich eine Strategie entwickelt:
Ich ignorierte alles.
Ich stand auf, wenn ich aufwachte.
Ich aß, wenn ich hungrig war.
Ich antwortete auf Nachrichten, wenn ich sie verstand – zeitlich oder semantisch, das war egal.
Ich war endlich frei.
Das Universum quittierte das mit einem Google-Kalendereintrag, der mir sagte:
„USA: Ende der Sommerzeit in 23 Tagen.“
Ich lachte.
Ich lachte lange.
Ich lachte so sehr, dass mein Hund kurz verstört den Raum verließ.
Denn jetzt begann das Spiel rückwärts.
Deutschland würde später nachziehen.
Und ich?
Ich war wie ein Sumpfvogel, der irgendwo zwischen den Jahreszeiten hängen geblieben war.
Nicht mehr Teil der warmen, logischen Zeiträume.
Sondern ein Wesen, das sich mühsam durch das Gewebe synchronisierter Verwirrung wühlt.
Und weißt du was?
Ich gewöhnte mich daran.
Nach exakt sechs Monaten hatte mein Körper es verstanden.
Meine Gedanken waren sortiert.
Meine Kalender funktionierten.
Ich wusste wieder, wann „jetzt“ war.
Es war ein Triumph.
Ich war synchronisiert mit der Welt.
Der Jetlag war besiegt.
Zwei Tage später:
Deutschland stellte wieder um.
Die USA folgten eine Woche später.
Und mein Gehirn?
Machte sich ein Sandwich und ging schlafen.
ENDE.
(Titelmusik: Ein leiser Wecker klingelt – niemand reagiert.)



[…] Wenn mein Gehirn Jetlag hat, ohne sich zu bewegen […]