Der Moment
Es war ein Dienstag.
Nicht, dass der Tag etwas dafür konnte, aber es war einer von diesen Dienstagen, die sich wie der Fußboden unter einem billigen Teppich anfühlen – strukturlos, leicht klebrig, irgendwie da, aber eigentlich überflüssig.
Ich saß am Küchentisch.
Kaffee, mittelwarm. Brötchen, aufgebacken. Blick, leer. Gehirn, im Leerlauf.
Und dann passierte es.
Ich hatte einen Gedanken.
Er kam nicht laut. Kein Tusch, keine Fanfarenträger, nicht einmal ein dezentes „Pling“.
Er war einfach… da.
Schleichend, elegant, ein bisschen wie diese Kellner in sehr teuren Restaurants, die dir Wasser nachschenken, ohne dass du’s merkst.
Ich hatte ihn nicht gerufen. Und trotzdem war er plötzlich mitten im Raum.
Ein Gedanke.
Nicht irgendeiner.
Ein Guter.
Einer, der Potenzial hatte.
Einer, der… wenn ich ihn festhielt, vielleicht sogar zu einem Essay, einem Blogartikel oder – wer weiß – einem Satz auf einer Tasse werden könnte.
Ich griff nach ihm.
Metaphorisch natürlich.
Aber er… war schneller.

Die Verfolgung
Ich sprang auf.
Also, innerlich. Äußerlich blieb ich sitzen, weil meine Knie mir inzwischen bei jedem spontanen Bewegungswunsch eine Art Warnhinweis schicken. Aber geistig? Volle Sprintbereitschaft.
Der Gedanke war weg.
Nicht ganz weg, eher… verschwommen. Wie jemand, der gerade aus einem Zimmer geht und dabei in einem Nebel aus Zitronenschale und Schuldgefühl verschwindet.
Ich lief ihm hinterher.
Mit geschlossenen Augen.
Manchmal hilft das.
Gedanken mögen Dunkelheit – dort fühlen sie sich unbeobachtet und kommen eher zurück.
Nichts. Nur die Einkaufsliste.
„Hafermilch, Klopapier, Gurken, vielleicht neue Batterien.“
„GURKEN?!“ schrie ich innerlich, „Ich hatte gerade die Idee meines Lebens und du gibst mir Gurken?!“
Ich rannte ins Wohnzimmer.
Da war er kurz wieder, der Gedanke.
Ein Hauch von Struktur, eine Idee von einem Anfang.
Etwas mit… „Wenn alles gleichzeitig möglich ist, warum…“
Und dann war er wieder weg.
Verdammt.
Ich griff zum Stift, zum Notizbuch, zum Handy.
Natürlich hatte ich kein Notizbuch zur Hand. Und mein Handy?
War ausgerechnet heute nicht bei mir. Ich hatte es bewusst im Schlafzimmer gelassen, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass kreative Menschen sowas machen.
Wie ironisch.
Gerade eben war ich vielleicht kreativ gewesen.
Jetzt war ich nur noch… außer Atem.
Ich suchte in Schubladen, im Kopf, in Teetassen nach Restgedanken.
Aber alles, was blieb, war das dumpfe Gefühl:
Ich hatte etwas. Etwas Gutes. Etwas mit Substanz. Und jetzt jagte ich einem Schatten hinterher.

Die Theorie der flüchtigen Gedanken
Ich habe eine Theorie.
Sie kam zu mir, während ich suchte. Also vermutlich ein Ersatzgedanke.
Ein Trostgedanke.
Aber vielleicht trotzdem brauchbar.
Meine Theorie ist:
Gedanken sind wie Katzen.
Sie kommen nur, wenn sie wollen.
Und sobald man sie zu sehr beachtet, verlieren sie das Interesse.
Ich meine, da ist man, völlig unvorbereitet, zack – ploppt ein brillanter Gedanke auf, rollt sich schnurrend zwischen zwei Hirnwindungen zusammen, schnurrt und flüstert: „Schreib mich auf. Nutz mich. Ich bin der Anfang von allem.“
Und was macht man?
Man bewegt sich zu schnell.
Man greift.
Man will ihn behalten.
Und schwupp – weg ist er.
Vielleicht sind Gedanken sogar noch schlimmer als Katzen.
Katzen kommen immerhin manchmal zurück.
Gedanken… die wirklich guten… tun das selten.
Ich setzte mich wieder hin.
Diesmal mit Stift und Papier.
Nicht um den Gedanken zurückzuholen – ich hatte inzwischen akzeptiert, dass er weg war – sondern um aufzuschreiben, dass er weg war.
Das, dachte ich, sei immerhin ehrlich.
Und vielleicht auch schon Literatur.
Ich notierte:
„Ich hatte einen Gedanken. Aber er war schneller als ich.“
Dann sah ich die Zeile an.
Und lächelte.
Vielleicht war das der Gedanke gewesen.
Oder vielleicht hatte ich, während ich den alten jagte, aus Versehen einen neuen geboren.
Aber dann – gerade in dem Moment, in dem ich mich zufrieden zurücklehnen wollte – passierte es.
Ich hörte ein Flüstern.
Nicht akustisch. Eher wie ein Gedankenecho.
Und dieser Gedanke war nicht meiner.
Er sagte:
„Du hast mich nie gehabt.“

Die Wahrheit
Ich starrte auf den Satz:
„Du hast mich nie gehabt.“
Er stand da, als hätte ihn jemand auf die Rückseite meiner Stirn geschrieben.
Mit feiner, leiser Tinte.
Ein Gedanke, der sich nicht anfassen ließ, aber trotzdem wie ein kalter Luftzug unter der Haut spürbar war.
Ich war mir sicher, dass ich ihn gehört hatte.
Nicht mit den Ohren – mit diesem inneren Organ, das wir benutzen, wenn wir uns selbst belügen oder heimlich hoffen, dass etwas Magisches passiert.
„Wie meinst du das?“, fragte ich laut.
Niemand antwortete. Natürlich nicht.
Aber ich spürte plötzlich eine gewisse… Distanz.
So, als hätte ich bisher geglaubt, ich sei allein in meinem Kopf – und nun stellte sich heraus, ich war es nicht.
Ich ging ins Bad.
Schaute in den Spiegel.
Und da passierte es.
Ein Gedanke – nicht mein Gedanke – trat vor.
Ganz ruhig. Ganz präsent.
Und ich sah mich.
Also wirklich mich.
Nicht das gewohnte Gesicht, sondern etwas Dahinter.
Etwas Fremdes.
Etwas, das mich betrachtete.
Und dann verstand ich:
Ich war nie derjenige, der dachte.
Ich war derjenige, der gedacht wurde.
Die ganzen Gedanken, die kamen, die gingen, die ich zu kontrollieren glaubte – sie waren nicht meine.
Sie hatten mich benutzt.
Ich war nur der Kanal.
Das Gefäß.
Der Träger.
Ich – war ein Gedanke.
Ein Gedanke, den sich jemand anderes ausgedacht hatte.
Ein flüchtiger Impuls in einem anderen Bewusstsein.
Eine Idee, die gerade verblasste.
Und bevor ich mich auflösen konnte, bevor ich endgültig verschwand, dachte ich noch:
Vielleicht war ich ja gar nicht zu langsam.
Vielleicht… war ich einfach zu kurz.
Und dann war ich weg.






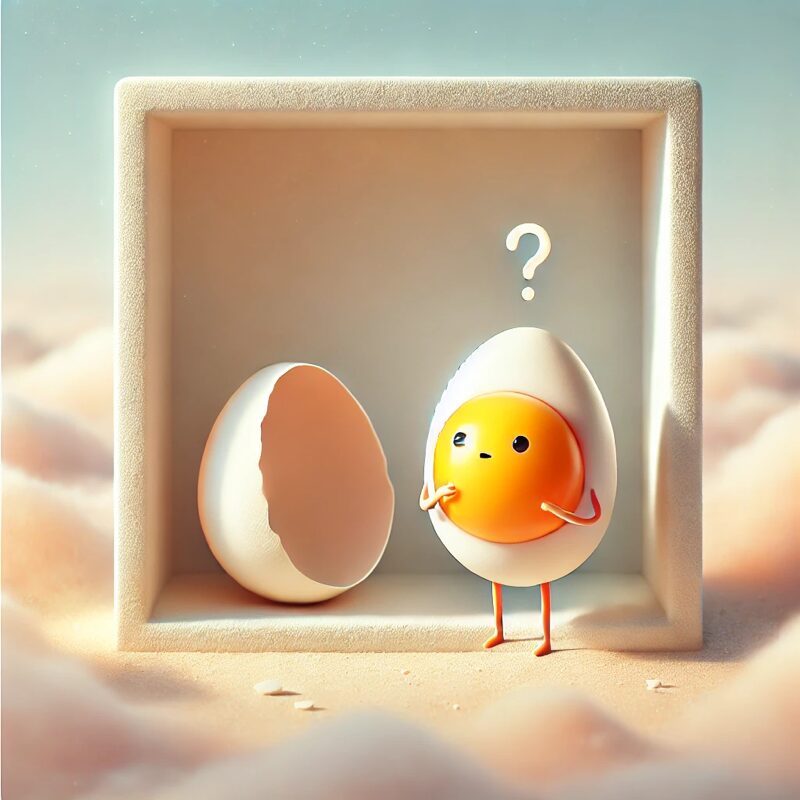
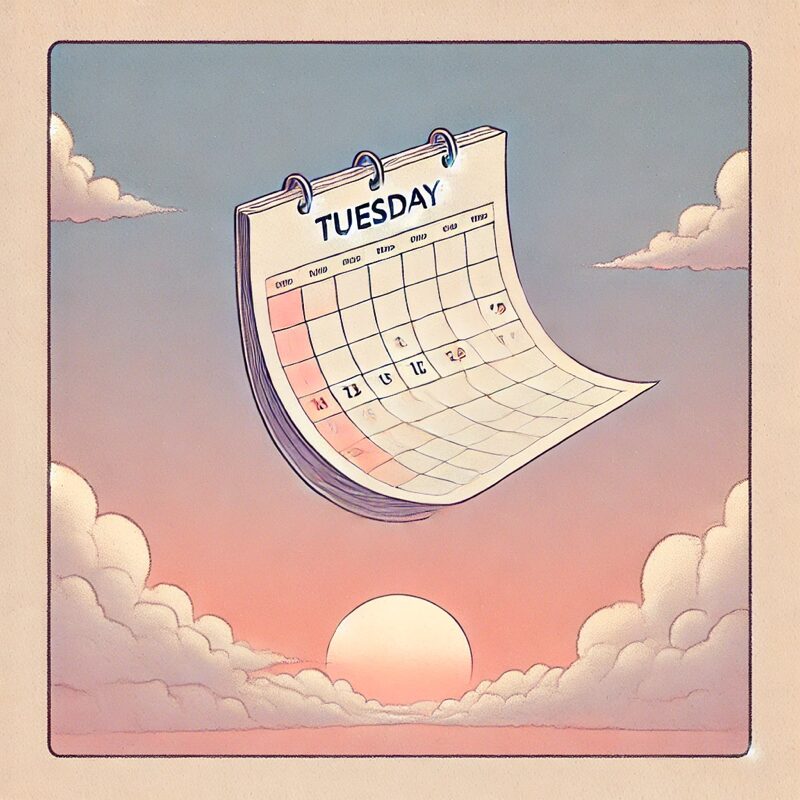

[…] Ich hatte einen Gedanken. Aber er war schneller als ich. […]